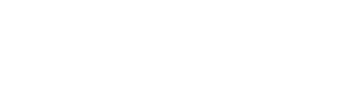Bis zum Jahr 2030 plant die Bundesregierung eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auf mindestens 80 Prozent. Zunehmende Strommengen aus erneuerbaren Energien in den Strommarkt und die -netze zu integrieren, stellt erhebliche Herausforderungen an die Weiterentwicklung des Stromsystems wie auch die eingesetzten Technologien. Denn Systemstabilität, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit müssen weiterhin gewährleistet sein.
Der für die Klimaneutralität notwendige massive Ausbau der erneuerbaren Energien stellt erhebliche Anforderungen an den Ausbau der Stromnetze. Um diese so effizient wie möglich nutzen zu können und den Ausbau so klein wie möglich zu halten, ist es zukünftig erforderlich auch den Stromverbrauch zu flexibilisieren. Ein erheblicher Anteil des Stromverbrauchs wird dann an die momentane Leistungsfähigkeit der Erneuerbaren im Netz angepasst. Heute werden durch die Netzbetreiber erneuerbare Energien abgeregelt, wenn Netzengpässe drohen. Dabei geht wertvoller erneuerbarer Strom verloren, während gleichzeitig umlagefähige Kosten entstehen. Zukünftig soll durch den netzdienlichen Betrieb von Stromerzeugern und Stromverbrauchern mehr erneuerbare Energien in die Netze aufgenommen und genutzt werden. So können wir schneller große Mengen Erneuerbare ans Netz bringen und langfristig den Netzausbau auf ein vertretbares Maß begrenzen.
Speichern kommt eine bedeutende Rolle in der Energiewende zu, sie sind aber noch vergleichsweise teuer. Speicher können grundsätzlich Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ausgleichen, sie müssen aber möglichst effizient eingesetzt werden.
In Mecklenburg-Vorpommern beträgt der erzeugte Strom aus Erneuerbaren Energien schon seit einigen Jahren über 200 Prozent des eigentlichen Bedarfes. Damit werden wir zum Reallabor für intelligente Energiesysteme – die stärkere Anpassung der Stromverbräuche an die Stromerzeugung durch die Flexibilisierung des Bezugs. Die Potenziale sind noch längst nicht ausgeschöpft, denn der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung beträgt heute knapp 15 Prozent. Im Verkehrssektor werden hingegen nur ca. 2% (2023) des Endenergieverbrauchs1 durch elektrischen Strom gedeckt (bei einer erneuerbaren Quote von knapp 60% im Jahr 2023).
Aktuelle Studien prognostizieren, dass etwa 100 TWh (ca. 20%) des deutschen Stromverbrauchs flexibilisiert werden können. Durch diese Verlagerung der Stromverbräuche können ca. 4,8 Milliarden Euro bei den Stromsystemkosten eingespart werden.
Mit unserem Projekt wollen wir die auch für Mecklenburg-Vorpommern und erarbeiten, welche Methoden zur notwendig sind, um von, flexiblen und zu profitieren. Eine Reduzierung der Stromsystemkosten in Mecklenburg-Vorpommern ist im Sinne volkswirtschaftlicher Effizient bereits grundsätzlich angezeigt. Darüber hinaus ist jedoch auch ein Vorteil für die Endkunden ersichtlich, die von geringeren Umlagen und durchschnittlich geringeren Arbeitspreises profitieren könnten.
Speicher können grundsätzlich Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Mecklenburg-Vorpommern ausgleichen, sie müssen aber möglichst effizient eingesetzt werden. Hier gilt es teilweise diverse Entwicklungen der vergangenen Jahre im Sinne der Sektorenkopplung zu verknüpfen:
(I.) Insbesondre die Stadtwerke haben mit der Errichtung großer Wärmespeicher (z.B. in Schwerin, Rostock, Neubrandenburg, Greifswald) sowie Power-to-Heat-Anlagen Grundvoraussetzungen für die Integration und Kopplung verschiedener Energieerzeugungsanlagen geschaffen. Diese werden jedoch künftig mit (II.) der Produktion von Wasserstoff um den Zugang zu elektrischem Strom als Primärenergiequelle konkurrieren. Gleichzeitig (III.) ist ein rasanter Markthochlauf im Bereich der Batteriespeicher zu beobachten, die sich einerseits in Privathaushalten finden aber andererseits auch im Megawattbereich mit PV-Freiflächenanlagen oder Windkraftanlagen kombiniert werden bzw. direkt als Netzstabilisatoren an zentralen Verknüpfungspunkten zu finden sind. Der starke Preisverfall im Bereich stationärer Speicher, der künftig durch den Hochlauf noch günstigerer und deutlich umweltverträglicher Natrium-Ionen-Batterien ergänzt werden dürfte, könnte so auch zum Treiber bei der Entwicklung intelligenter Energiesysteme werden. Im Hinblick auf diese Speichersysteme gilt es demnach, Kenntnisse auf allen Ebenen zu fördern und Informationen über Marktentwicklungen und technische Innovationen im Rahmen flexibler Netze in Mecklenburg-Vorpommern zu verbreiten.
Das Vorhaben „Durch Intelligente Netze, Sektorenkopplung und Speichersysteme die Kosten der Energiewende senken“ soll auf die genannten Umstände aufmerksam machen und so die Akzeptanz der Erneuerbaren Energien in der Bevölkerung steigern. Aber vor allem soll sich mit Akteuren der Energiewende ausgetauscht werden, wie die Energiewende durch intelligente Stromsysteme in Mecklenburg-Vorpommern vorangehen kann.